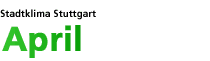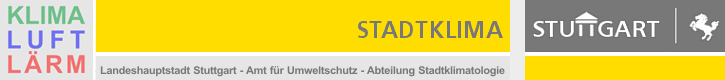A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
39. BImSchV
NeununddreiĂigste Verordnung zur DurchfĂŒhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung ĂŒber LuftqualitĂ€tsstandards und Emissionshöchstmengen), 2. August 2010
6. AllgVwV z. BImSchG
TA LĂ€rm
98-Perzentil
98%-Wert der SummenhĂ€ufigkeit. Dient der Beurteilung der Spitzenbelastung (MaĂ fĂŒr mittlere Spitzenbelastung). Nur 2 Prozent aller MeĂwerte dĂŒrfen diesen Wert ĂŒberschreiten.

Abgase
Sammelbegriff fĂŒr gasförmige Emissionen, die aus Feuerungs- und Produktionsanlagen sowie aus Kraftfahrzeugen, aber auch aus Böden oder Deponien austreten. Abgas im StraĂenverkehr wird von allen Fahrzeugen verursacht, die mit einem Verbrennungsmotor angetrieben werden - also von jedem fahrbaren Untersatz, der nicht durch Muskelkraft, Sonnenenergie oder Elektroantrieb bewegt wird. Die Abgase - pro Liter verbrauchtem Kraftstoff rund 10 m3 - enthalten Schadstoffe, wie z.B. Kohlenmonoxid, Stickstoffoxide, Kohlenwasserstoffe, RuĂ und Schwermetalle. Da sie umwelt- und gesundheitsschĂ€dlich sind, wurden bestimmte Abgasgrenzwerte eingefĂŒhrt. Diese wurden in der Vergangenheit bereits mehrfach verschĂ€rft und werden auch weiterhin abgesenkt. FĂŒr die Betriebszulassung neuer Fahrzeugtypen ist auĂerdem ein AbgasprĂŒfverfahren vorgeschrieben, das wie die Abgasuntersuchung (AU) von amtlich anerkannten SachverstĂ€ndigen durchgefĂŒhrt wird. Zu den technischen Möglichkeiten, den AusstoĂ von Schadstoffen zu verringern, zĂ€hlen der geregelte Drei-Wege-Katalysator, der ungeregelte Katalysator, der Oxidations-Katalysator, der RuĂfilter, die AbgasrĂŒckfĂŒhrung, die Ănderung der Motorkonstruktionen (Mager-Mix-Motor), das Motor-Management (z.B. elektronische KennfeldzĂŒndung) und die Ănderung der Kraftstoffzusam-mensetzung.
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen BaulÀrm - GerÀuschimmissionen
Aromatische Kohlenwasserstoffe
Ringförmige Kohlenwasserstoffverbindungen (z.B. Benzol, Ethylbenzol, Toluol, Xylol) kommen z.B. in Treibstoffen, Klebern, (Nitro-) Lacken, VerdĂŒnnern und vielen anderen Produkten vor. Sie können auch in der AuĂenluft vorkommen.
Astronomische DĂ€mmerung
Die astronomische DÀmmerung ist definiert als diejenige Zeitdauer, in der die Sonnenhöhe zwischen 0 und -18 Grad ist, d.h. die Zeitdauer, in der die Sonne sich zwischen 0 und 18 Grad unter dem Horizont befindet. Es gibt somit sowohl morgens wie auch abends eine astronomische DÀmmerung.
AtmosphÀre
AtmosphĂ€re nennt man die LufthĂŒlle, die unsere Erde umgibt. Sie besteht aus Stickstoff (ca. 78%) und Sauerstoff (ca. 21%) sowie Spurengasen. AuĂerdem enthĂ€lt sie Staub sowie Wasser, das sie aus der Verdunstung der Meere, Seen und FlĂŒsse aufnimmt und bei Ăber-schreitung des SĂ€ttigungsgrades als Niederschlag an die Erde zurĂŒckgibt. Bedeutsam ist auch das in der oberen AtmosphĂ€re enthaltene Ozon als Filter gegen die harte UV-B-Strahlung der Sonne.
Ausbreitungsklassen
Beschreiben die dynamische StabilitÀt der AtmosphÀre. Ausbreitungsklassen werden z.B. nach den Vorgaben der TA-Luft (TA LUFT 1986) aus meteorologischen Parametern wie Windgeschwindigkeit, Bedeckungsgrad und Sonnenstand berechnet.
Azimut
Sonnenwinkel gemessen von der wahren SĂŒdrichtung in der nördlichen HemisphĂ€re. Westlich positiv, östlich negativ
Benzol
Von den aromatischen Kohlenwasserstoffen kommt dem Benzol wegen seines karziogenen Charakters aus medizinischer Sicht besondere Bedeutung zu. Diese Komponente ist aufgrund ihres Vorhandenseins im Benzin und im Autoabgas weit verbreitet.
Bezugsjahr
Das Jahr, fĂŒr welches die Emissionsfaktoren eines Fahrzeugkollektives erhoben wurden.
BIMSCHG
AbkĂŒrzung fĂŒr Bundes-Immissionsschutzgesetz
Bioklimatologie
Wirkung des Klimas auf den Menschen.
Blei
Blei, ein blĂ€ulichweiĂes weiches Schwermetall, gehört zu der Gruppe der partikelförmigen Luftschadstoffen. Die biologische Halbwertszeit von Blei ist sehr lang, so daĂ auch bei Aufnahme von nur geringen Mengen an Blei ĂŒber lĂ€ngere Zeit im Körper toxikologisch relevante Konzentrationen angereichert werden. Blei wirkt hemmend auf die Bildung von HĂ€moglobin und fĂŒhrt so zu VerĂ€nderungen im Blutbild. In höheren Konzentrationen beeintrĂ€chtigt Blei die Funktion des zentralen Nervensystems.
Bodeninversion
AtmosphÀrenschicht mit inversem Temperaturverlauf (Temperaturzunahme mit der Höhe), die dem Erdboden aufliegt.
BĂŒrgerliche DĂ€mmerung
Die bĂŒrgerliche DĂ€mmerung ist definiert als diejenige Zeitdauer, in der die Sonnenhöhe zwischen 0 und -6,5 Grad ist. Die bĂŒrgerlichen DĂ€mmerung ist kĂŒrzer als die astronomische und die nautische DĂ€mmerung.
Sie ist die Zeit, wĂ€hrend der man ohne kĂŒnstliche Beleuchtung noch lesen kann.
Cadmium
Cadmium reichert sich ĂŒber die Nahrungskette in Pflanzen und Tieren, aber auch im menschlichen Körper an, was zu SchĂ€digung an Leber und Nieren fĂŒhren kann. Die Inhalation von Cadmium und Cadmiumverbindungen in Form von StĂ€uben und Aerosolen ist in der Gefahrenstoffverornung als krebserzeugend ausgewiesen.
Dezibel
Logarithmischer MaĂstab fĂŒr die Schalldruckpegelskala (AbkĂŒrzung dB). In Dezibel werden GerĂ€uschpegel gemessen. Die Angabe in dB (A) berĂŒcksichtigt darĂŒber hinaus die frequenzab-hĂ€ngige Empfindlichkeit des menschlichen Ohrs. Das nach einem amerikanischen Ingenieur benannte "Bel" ist keine physikalische Einheit, sondern lediglich wie der Begriff "Prozent" ein Kenn- oder Hinweiswort. Es besagt, dass eine physikalische GröĂe (meist eine Leistung) als dekadischer Logarithmus des VerhĂ€ltnisses eines Wertes dieser GröĂe zu einer festgelegten BezugsgröĂe dargestellt wird. Das Ergebnis nennt man Pegel. 1 Bel = 10 deziBel = 10 dB.
Dezibel (A)
A-Bewertung: Das menschliche Ohr empfindet Töne gleichen Schalldrucks je nach Frequenz (Tonhöhe) unterschiedlich laut. So werden hohe Töne vergleichsweise lauter empfunden als tiefe Töne. Um eine wahrnehmungsgetreue messtechnische Erfassung von GerĂ€uschen zu ermöglichen, wird der Sachverhalt einer frequenzabhĂ€ngigen LautstĂ€rkeempfindung in LĂ€rmmessgerĂ€ten dadurch berĂŒcksichtigt, dass die auftretenden Frequenzen des zu messenden GerĂ€usches im Schallpegelmesser unter Anpassung an das menschliche Hörorgan mit Hilfe von Filtern verschieden stark gedĂ€mpft werden.
Direkte Sonnenstrahlung
Anteil der Solarstrahlung, der die Erde ohne AbschwÀchung (Extinktion) erreicht; bezogen auf die horizontale FlÀche; Einheit: Watt pro Quadratmeter ( W/m2 )
Durchschnittliche TÀgliche VerkehrsstÀrke
Auf alle Tage des Jahres bezogener Mittelwert der einen StraĂenquerschnitt tĂ€glich passierenden Fahrzeuge in Kfz/24h.
EG-Leitwerte
In Richtlinien der EU festgelegte Leitwerte fĂŒr einzelne Schadstoffkomponenten, deren Einhaltung anzustreben ist.
Einstrahlung
Die Erde erhĂ€lt, wie die anderen Planeten unseres Sonnensystems, von der Sonne eine stĂ€ndige Energiezufuhr in Form von Strahlungsenergie. Von der Gesamtstrahlung der Sonne mit ca. 21·1027 J/min empfĂ€ngt die Erde an der AtmosphĂ€rengrenze ca. 8,4 J/cmÂČ min, was einer total zugestrahlten Energie von ca. 10,5·1018 J/min gleichkommt. Die pro cmÂČ und min zugestrahlte Energie an der AtmosphĂ€rengrenze wird als Solarkonstante bezeichnet (Schwankung 5%). Durch Absorptions-, Zerstreuungs- und RelexionsvorgĂ€nge in der AtmosphĂ€re, den Wolken und am Boden wird dem Erdboden im Mittel nur die Strahlungsenergie von ca 2,1 J/cmÂČ min zugefĂŒhrt.
Eistag
Tag mit Maximumtemperatur unter 0 Grad C
Emission
Emissionen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sind die von einer Anlage ausgehenden V+H33erunreinigungen, die durch StĂ€ube und Gase, GerĂ€usche, ErschĂŒtterungen, Licht, WĂ€rme, Strahlen und Ă€hnliche Erscheinungen hervorgerufen werden.
Emissionsfaktoren
Emissionen eines einzelnen Pkw bzw. Lkw durchschnittlicher Beschaffenheit in g/km. Die Emissionsfaktoren sind insbesondere von der Fahrzeugkategorie (Pkw, Lkw, Busse, Mofas, etc.), vom Bezugsjahr und der Verkehrssituation abhĂ€ngig. ZusĂ€tzlich können auch StraĂensteigungen sowie KaltstartzuschlĂ€ge berĂŒcksichtigt werden. Die aktuellen Emissionsfaktoren sind dem UBA-Handbuch (UMWELTBUNDESAMT (UBA) (HRSG.) 1999) zu entnehmen.
Emissionskataster
RÀumliche Verteilung der Emissionen, in der Regel bezogen auf QuadratkilometerflÀchen.H31
Extinktion
Unter Extinktion versteht man die SchwĂ€chung der Solarstrahlung, hervorgerufen durch Streuung an LuftmolekĂŒlen (Rayleigh-Streuung), Streuung an und in Aerosolen (Mie-Streuung), selektive Absorption durch Gase sowie diffuse Reflexion und Beugung an Teilchen. Durch die Extinktion wird die spektrale Charakteristik als auch die IntensitĂ€t der Solarstrahlung verĂ€ndert. Die AtmosphĂ€re, die bis in groĂe Höhen aus dem Gasgemisch Luft besteht hat einen konstanten schwĂ€chenden EinfluĂ auf die Sonnenstrahlung, doch ist die AbschwĂ€chung von der Sonnenhöhe abhĂ€ngig, da abhĂ€ngig von dem Sonnenstand der Weg durch die AtmosphĂ€re unterschiedlich lang ist. ZusĂ€tzlich zu den konstanten Bestandteilen der AtmosphĂ€re treten jedoch auch schwankende Bestandteile auf, so z.B. Wasserdampf, Ozon, und Schadgase wie Schwefeldioxid, Kohlenstoffmonoxid, Stickoxide und Aerosole. Durch die selektive Absorption dieser Stoffe wird die Strahlung ebenfalls geschwĂ€cht, wobei hier die Konzentration eine wesentliche Rolle spielt. Die Streuung an MolekĂŒlen ist der vierten Potenz der WellenlĂ€nge umgekehrt proportional, d.h. kĂŒrzere WellenlĂ€ngen werden stĂ€rker gestreut (Himmelblau !). Bei der Streuung an Teilchen gröĂer 10 m m werden alle WellenlĂ€ngen etwa gleich gestreut. Bei starker Ansammlung von Aerosolen, wie es in Ballungsgebieten z.T. vorkommt, erhĂ€lt der Himmel ein milchigweiĂes Aussehen.
Fluorchlorkohlenwasserstoffe
Abk. fĂŒr Fluorchlorkohlenwasserstoffe. Es sind niedermolekulare Kohlenwasserstoffe, bei denen einige oder alle Wasserstoffatome gegen Fluor- und/oder Chloratome ausgetauscht wurden. Diese Substanzen sind sehr stabile und nicht brennbare Gase, weshalb sie als Treibmittel fĂŒr Lebensmittel und Kosmetika und als KĂ€ltemittel fĂŒr Klimaanlagen und KĂŒhlschrĂ€nke eingesetzt wurden. Heute weiĂ man, daĂ F. in hohem MaĂe fĂŒr die Zerstörung der Ozonschicht verantwortlich sind, da sie in der AtmosphĂ€re in groĂer Höhe vom energiereichen Sonnenlicht gespalten werden und Chlorverbindungen entstehen, die das Ozon angreifen und zerstören (Ozonloch).
Frosttag
Tag mit Minimumtemperatur unter 0 Grad C.
Geneigte FlĂ€chen und ĂŒberhöhter Horizont
Solarstrahlung, Verschattung, Himmelsstrahlung und Reflexstrahlung, Globalstrahlung
GerÀusch
Bei einem GerĂ€usch handelt es sich nach DIN 1320 um ein Schallsignal, welches meistens ein nicht zweckgebundenes Schallereignis charakterisiert, z.B. Maschinen- und FahrzeuggerĂ€usche. Aus dieser Definition geht der zufĂ€llige, ungeordnete Charakter von GerĂ€uschen hervor, denn es handelt sich um Tongemische, die sich aus sehr vielen Einzeltönen zusammensetzen. Das GerĂ€usch ist demnach ein akustisches Signal mit zahlreichen Frequenzen, zwischen denen kein gesetzmĂ€Ăiger Zusammenhang besteht, wie dies z.B. beim Klang der Fall ist. Auch bei GerĂ€uschen können infolge periodischer VorgĂ€nge Einzeltöne hervortreten, welche dem durch ein breites Frequenzband gekennzeichneten GerĂ€uschanteil ĂŒberlagert sind. Solche Einzeltöne erhöhen die Störwirkung von GerĂ€uschen erheblich und werden daher bei der (GerĂ€usch-) Beurteilung durch einen sog. Tonzuschlag berĂŒcksichtigt.
Gesamtbelastung
Immissionsbelastung, die sich aus der Vorbelastung und der Zusatzbelastung durch die StraĂe ergibt.
Gesamtstrahlung
Summe aus der direkten Sonnenstrahlung und dem diffusen Anteil des Sonnenlichts, das vom blauen Himmel und den Wolken kommt; bezogen auf die reale, geneigte FlÀche. Einheit: Watt pro Quadratmeter ( W/m2 )
Globalstrahlung
Summe aus der direkten Sonnenstrahlung und dem diffusen Anteil des Sonnenlichtes, das vom blauen Himmel und den Wolken kommt.
Globalstrahlung
Summe aus der direkten Sonnenstrahlung und dem diffusen Anteil des Sonnenlichtes, das vom blauen Himmel und den Wolken kommt; bezogen auf die horizontale FlÀche; Einheit: Watt pro Quadratmeter ( W/m2 )
Globalstrahlung
Unter der Globalstrahlung versteht man die Summe aus direkter Sonnenstrahlung und diffuser Himmelsstrahlung auf die horizontale FlĂ€che. Es ist leicht verstĂ€ndlich, daĂ die Globalstrahlung von der Sonnenhöhe, der Seehöhe, der TrĂŒbung, der Bewölkung und Feuchtigkeit etc. abhĂ€ngt und somit selbst in der Bundesrepublik groĂe Unterschiede aufweist. Der Verlust durch Streuung mit Aerosolen ist fĂŒr die Globalstrahlung geringer als bei der direkten Sonnenstrahlung doch kann bei hohen Staubkonzentrationen (z.B. industrielle VerdichtungsrĂ€ume) die Globalstrahlung insbesondere bei niedriger Sonnenhöhe durchaus um 30% reduziert werden. Die mittlere Jahressumme der Globalstrahlung betrĂ€gt z.B. in Stuttgart-Hohenheim fĂŒr den 30jĂ€hrigen Zeitraum 1961 bis 1990 402 kJ/cmÂČ, was einem Durchschnittswert der jĂ€hrlichen Strahlungsleistung von 127 W/mÂČ oder 1116 kWh/mÂČ Jahr entspricht. In der nachfolgenden Abbildung wird die Verteilung der durchschnittlichen Sonnenscheindauer und der jĂ€hrlichen Energielieferung der Sonne auf 1 mÂČ ErdoberflĂ€che fĂŒr den Bereich der Bundesrepublik Deutschland dargestellt. Die Sonnenschein-dauer umfaĂt hier die Spanne zwischen 1300 und 2000 Jahresstunden, wĂ€hrend sich die Globalstrahlung zwischen den Werten 780 bis 1240 kWh/mÂČ Jahr bewegt.
Globalstrahlung
Die Globalstrahlung setzt sich aus der direkten Solarstrahlung und der Himmelsstrahlung zusammen, hinzu kommt ggf. noch die Reflexstrahlung von HĂ€ngen und WĂ€nden, so daĂ spektrale VerĂ€nderungen auftreten können. Durch den Sonnentiefstand am Abend und Morgen kommt es so z.B. bei der Besonnung an West- und OsthĂ€ngen zu einer Rotverschiebung, wĂ€hrend bei NordhĂ€ngen, die stark von der Himmelsstrahlung beeinfluĂt werden eine hoher Blauanteil vorherrscht (Blaustich bei Fotos im Schatten!). Durch die Exposition und Neigung der HĂ€nge und WĂ€nde kommt es zu starken IntensitĂ€tsschwankungen, die besonders bei wolkenlosem Himmel groĂ sind. Eine leichte Bewölkung schwĂ€cht diese Unterschiede ab, bei dichter Bewölkung sind sie weitgehend aufgehoben. Durch eine HorizontĂŒberhöhung (Abschattung) wird die Globalstrahlung abgeschwĂ€cht, wobei beide Anteile sowohl die direkte Sonnenstrahlung als auch die Himmelsstrahlung eine AbschwĂ€chung erfahren. Die fĂŒr Anwendungen im Bereich der Solartechnik erforderlichen detaillierten Statistiken der Globalstrahlung findet man im umfangreichen ATLAS ĂBER DIE SONNENSTRAHLUNG EUROPAS (1984), wobei sich Band 1 auf horizontale FlĂ€chen und Band 2 auf geneigte FlĂ€chen bezieht. Der Anhang J der VDI-RICHTLINIE 3789, Blatt 2, Umweltmeteorologie (Entwurf, 1992) enthĂ€lt Hinweise auf Datensammlungen ĂŒber die StrahlungsverhĂ€ltnisse in Deutschland, Europa und in auĂereuropĂ€ischen Regionen. Die Globalstrahlung hat ihr Maximum in Richtung auf den jeweiligen Sonnenstand. Sonnenenergienutzung beruht somit auch in der einfachsten Form auf optimaler Exposition der fĂŒr den Energieumsatz vorgesehenen bzw. bauphysikalisch dafĂŒr geeigneten FlĂ€chen und ihrer Verschattungsfreiheit. Grundlagen und wesentliche Arbeitshilfen zur Berechnung der Strahlung enthĂ€lt die VDI-RICHTLINIE 3789, Blatt 2, Umweltmeteorologie (Entwurf 1992). Die Orientierung von FlĂ€chen nach Himmelsrichtung und Neigungswinkel fĂŒhrt zu unterschiedlichen EinstrahlungsbetrĂ€gen, wobei die tages- und jahreszeitlichen VerĂ€nderungen des Sonnenstandes zu berĂŒcksichtigen sind. (Zwischen Sommer- und Wintersonnenwende Ă€ndert sich der Sonnenstand (Sonnenhöhe) am Mittag in Stuttgart um immerhin 47° !) So verschiebt sich im Winter das Strahlungsmaximum wegen des niedrigeren Sonnenstandes zu stĂ€rker nach SĂŒden geneigten FlĂ€chen.
Gradtagzahl
Die Gradtagszahl ist die Summe der tĂ€glichen Differenzen zwischen der mittleren Raumtemperatur von 20 Grad C und der mittleren AuĂenlufttemperatur. Das Tagesmittel der AuĂentemperatur wird errechnet aus den tĂ€glichen Luftemperaturmessungen um 7 Uhr, 14 Uhr und 21 Uhr mittlerer Ortszeit (MOZ).
Grundkonzentration
siehe Vorbelastung
Heisser Tag
Tag mit Maximaltemperatur von mindestens 30 Grad C.
Himmelsstrahlung
Diffuser Anteil des Lichts, der aus Absorption und Steuung an LuftmolekĂŒlen und Aerosolen resultiert. Einheit: Watt pro Quadratmeter ( W/m2 )
Himmelsstrahlung
Wie oben ausgefĂŒhrt, wird die Sonnenstrahlung beim Durchgang durch die AtmosphĂ€re gestreut. Ein Teil dieser gestreuten Strahlung (ca. 50%) erreicht die ErdoberflĂ€che und wird als Himmelsstrahlung (diffus !) bezeichnet. Wie die Sonnenstrahlung nimmt die Himmelsstrahlung mit der Sonnenhöhe zu. Bei zunehmender TrĂŒbung wird die Sonnenstrahlung geschwĂ€cht, wĂ€hrend die Himmelsstrahlung verstĂ€rkt wird. An einem wolkenlosen Tag betrĂ€gt die Strahlungssumme der Himmelsstrahlung in unseren Breiten 15-20% der Sonnenstrahlung. Da bei zunehmender Bewölkung (bis ca. 8/10) sich die Himmelsstrahlung erhöht, und Wolken bei uns hĂ€ufig auftreten, hat die Himmelsstrahlung eine groĂe Bedeutung. So erhalten wir bei den in höheren Breiten gegebenen BewölkungsverhĂ€ltnissen etwa gleich viel indirekte Himmelsstrahlung wie direkte Sonnenstrahlung.
Himmelsstrahlung und Reflexstrahlung
Ein Hang bzw. eine Hauswand empfĂ€ngt auĂer der direkten Solarstrahlung und Himmelsstrahlung auch reflektierte Strahlung von evtl. gegenĂŒberliegenden HĂ€ngen oder GebĂ€uden. Befinden sich sowohl Beobachtungsort als auch die betreffenden FlĂ€chen im Schatten, bzw. ist der Himmel bedeckt, sind keine groĂen spektralen VerĂ€nderungen gegenĂŒber der Himmelsstrahlung zu erwarten. Sind jedoch reflektierende FlĂ€chen von der Sonne beschienen (z.B. weiĂe Wand) der Beobachtungspunkt jedoch nicht, so werden die StrahlungsverhĂ€ltnisse erheblich verĂ€ndert.
Hitzestress
Bei WÀrmebelastung trotz Sommerkleidung werden die Thermoregulationsmechanismen des Organismus zunehmend gefordert. Die damit verbundene VerÀnderung der Durchblutung mit verstÀrktem Schwitzen weist auf die Belastung des Herz-Kreislauf-Systems und der Atmung hin. Eine Behinderung der WÀrmeabgabe bedeutet immer eine Belastung.
Horizontale FlÀchen
Solarstrahlung, Extinktion, Himmelsstrahlung, Globalstrahlung, Kurzwellige Strahlungsbilanz
Höheninversion
AtmosphÀrenschicht mit inversem Temperaturverlauf oberhalb der bodennahen AtmosphÀre.
Hörbereich
Das menschliche Ohr verfĂŒgt ĂŒber einen Wahrnehmungsbereich fĂŒr Schallschwingungen, deren Frequenz zwischen etwa 16 und 20 000 Schwingungen pro Sekunde (Hertz) liegt. Der Hörbereich weist auch in Bezug auf den Schalldruck eine untere Grenze, die so genannte Hörschwelle, auf. Der Schalldruck (genauer: Schallwechseldruck) entspricht den Druckschwankungen der Schallwellen und ist fĂŒr die LautstĂ€rkeempfindung maĂgebend, denn je gröĂer diese Druckschwankungen ausfallen, desto mehr Energie wird durch die Schallwellen ĂŒbertragen. Oberhalb der Schmerzgrenze ist das Hörereignis mit Schmerzempfindungen verbunden. Die Werte fĂŒr den Hörbereich (Schalldrucke) umfassen eine Skala, welche zwischen 0,00002 Pascal (Pa) und 200 Pa ĂŒber insgesamt 7 Zehnerpotenzen reicht, was die erstaunliche Wahrnehmungsleistung des Sinnesorganes Ohr dokumentiert. Gleichzeitig wird deutlich, dass eine auf den absoluten Schalldruck-Werten aufbauende lineare LautstĂ€rkeskala wegen der groĂen Spanne der Zahlenwerte Ă€uĂerst unzweckmĂ€Ăig wĂ€re. Der Hörschwelle ist (bei 1000 Hertz) der Schalldruck 2 x 10-5 Pa zugeordnet, was in der dB-LautstĂ€rkeskala dem Schallpegelwert 0 dB entspricht. Am oberen Ende der Skala liegt die Schmerzgrenze beim Schallpegelwert 140 dB; der Schalldruck betrĂ€gt dann 200 Pa.
Immission
Immissionen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sind auf Menschen sowie Tiere, Pflanzen oder andere Sachen einwirkende Luftverunreinigungen, GerĂ€usche, Er-schĂŒtterungen, Licht, WĂ€rme, Strahlen und Ă€hnliche Umwelteinwirkungen.
Immission
Luftverunreinigende Stoffe, die von der offenen AtmosphĂ€re in einen Einwirkungsbereich (Immissionsort) ĂŒbertreten.
Immissionskataster
RÀumliche Verteilung der Immissionen, in der Regel bezogen auf QuadratkilometerflÀchen
Immissionswerte IW1 und IW2
Immissionswerte fĂŒr Langzeitwirkungen (IW1 und Kurzzeitwirkungen (IW2) nach der TA-Luft (TA LUFT 1986).
Infrarot-Thermographie
Mit der Infrarot-Thermografie erhÀlt man ein Bild der momentanen Temperaturverteilung an der ErdoberflÀche mit hohem Auflösungsvermögen. Mit dem messenden Photometer im Flugzeug wird die Landschaft zeilenweise abgetastet (bei Flughöhe 3000 m Bodenauflösung von etwa 7m mal 7 m).
Inversion
Die Inversion bezeichnet einen vom Normalfall abweichenden vertikalen Temperaturver-lauf in der AtmosphĂ€re. Innerhalb einer Inversionsschicht nimmt die Lufttemperatur mit stei-gender Höhe zu, wĂ€hrend normalerweise AbkĂŒhlung mit der Höhe eintritt. Ein inverser Temperaturverlauf bewirkt eine stabile Schichtung der AtmosphĂ€re, d. h. innerhalb der Inversionsschicht sind keine vertikalen Umlagerungen der Luft möglich.
Jahresgang
Verlauf einer klimatischen oder lufthygienischen Komponente ĂŒber das Jahr.
Jahresmittelwert
Arithmetisches Mittel aller Âœ Stunden-, Stunden-, Tagesmittel- oder Monatsmittelwerte einer beobachteten Schadstoffkomponente ĂŒber ein Jahr.
Kaltluft-Volumenstromdichte
Die Kaltluft-Volumenstromdichte gibt ein MaĂ fĂŒr die Menge der abflieĂenden Kaltluft. Sie wird angegeben in Kubikmeter pro Sekunde und Querschnitt der Breite 1 Meter ĂŒber die gesamte betrachtete LuftschichtmĂ€chtigkeit.
Kaltluftfluss
Durch Temperaturunterschiede zwischen Berg und Tal bilden sich kleinrĂ€umige thermisch induzierte Windsysteme aus. Sie ĂŒberlagern sich den groĂrĂ€umigen Winden. So treten bei groĂrĂ€umig schwachem Wind, meist bei Hochdruckwetterlagen, insbesondere nachts tal- und hangabwĂ€rts gerichtete Lokalwinde (KaltluftflĂŒsse) auf.
kJ
AbkĂŒrzung fĂŒr Kilojoule
Klang
Schallschwingungen mit gesetzmĂ€Ăigem Zusammenhang (z.B. Dreiklang, d.h. drei Frequenzen evtl. unterschiedlicher Amplitude).
Klima
Das Klima bezeichnet den langfristigen Aspekt des Wetters. Es wird durch die Klimaelemente Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind, Niederschlag und Strahlung bestimmt.
Kohlenstoffmonoxid
Kohlenstoffmonoxid (CO) entsteht als Produkt einer unvollstĂ€ndigen Verbrennung von Kohlenstoff. CO ist farb-, geruchs- und geschmacklos. CO behindert die Sauerstoffaufnahme des Blutes. Ensteht bei allen Verbrennungsprozessen, Leitsubstanz fĂŒr un- oder nur teilweise verbrannte Kohlenwasserstoffe.
Kohlenwasserstoffe
Chemische Verbindungen des Kohlenstoffs mit Wasserstoff. Gliedern sich in kettenförmi-ge (z.B. Methan, Ăthan, Propan, Butan) und ringförmige (z.B. Benzol) Verbindungen. FĂŒr die Umweltbelastungen spielen insbesondere die ringförmigen (zyklischen und polyzyklischen) aromatischen K. (z.B. Benzpyren, Naphtalin) sowie die chlorierten und polychlorierten K. (z.B. PCB, Lindan, PCP, DDT, Dioxine) eine besondere Rolle.
Kurzwellige Strahlungsbilanz
Die kurzwellige Strahlungsbilanz beschreibt den Gewinn bzw. den Verlust an kurzwelliger Strahlung (0,3 - 3 m m). Die kurzwellige Strahlungsbilanz ist allein von den Unterschieden in der Einstrahlung und der Albedo (Reflexionsverhalten der ErdoberflĂ€che) abhĂ€ngig. Die jahreszeitlichen Schwankungen der Einstrahlung machen sich hier genauso bemerkbar wie die Ănderung der Albedo ĂŒber das Jahr (Schnee, Regen, Vegetation). Da die Reflexion maximal 100% der Einstrahlung betragen kann ist die kurzwellige Bilanz stets positiv d.h. mit einem Strahlungsgewinn verbunden.
Leitkomponenten
Da in unserer Umgebungsluft heutzutage leicht einige hundert oder auch tausend luftverunreinigende Komponenten vorhanden sind und viele davon nicht oder nur mit kaum vertretbarem technischen Aufwand meĂbar sind, ist man im Bereich der Luftreinhaltung ĂŒbereingekommen nur sogenannte Leitkomponenten zu erfassen, die dann in aller Regel stellvertretend fĂŒr eine ganze Gruppe von Schadstoffen stehen.
Lkw-Anteil
Anteil der Kraftfahrzeuge mit einem zulĂ€ssigen Gesamtgewicht ĂŒber 2,8 t in Prozent der durchschnittlichen tĂ€glichen VerkehrsstĂ€rke (DTV).
Luftreinhaltung
Luftreinhaltung ist das Ziel aller MaĂnahmen zur Erhaltung der natĂŒrlichen Zusammensetzung der Luft. Die MaĂnahmen mĂŒssen bereits an der Quelle (z.B. Maschine) ansetzen; hier sind Schadstofffreisetzungen zu vermeiden oder erheblich zu verringern. DarĂŒber hinaus sind, soweit notwendig, nachgeschaltete Techniken einzusetzen. Dazu werden in die Schornsteine der Fabriken und der WĂ€rmekraftwerke Filter eingebaut, mit denen die luftverunreinigenden Stoffe (Rauch, Staub, Gas, DĂ€mpfe, Geruchsstoffe) in unterschiedlichem AusmaĂ zurĂŒckgehalten werden. Beim Auto ist die wirksamste MaĂnahme der geregelte Drei-Wege-Katalysator.
Luftverunreinigungen
Luftverunreinigungen im Sinne des BImSchG sind VerĂ€nderungen der natĂŒrlichen Zusammensetzung der Luft, insbesondere durch Rauch, RuĂ, Staub, Gase, Aerosole, DĂ€mpfe oder Geruchsstoffe.
LĂ€rm
Störender Schall bzw. störende GerÀusche werden als LÀrm bezeichnet. Der Begriff LÀrm enthÀlt somit eine negative Wertung physikalisch neutraler Begriffe.
m. ĂŒ. NN
AbkĂŒrzung fĂŒr Meter ĂŒber Normalnull, d. h. Meter ĂŒber dem Meeresspiegel.
Merkblatt ĂŒber Luftverunreinigungen an StraĂen
Merkblatt ĂŒber Luftverunreinigungen an StraĂen (FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FĂR STRASSEN- UND VERKEHRSWESEN (FGSV) (HRSG.) 2002).
MEZ
MitteleuropÀische Zeit; MEZ = MOZ + ( l + 1h ) mit l als geografische LÀnge im Stundenwinkel, östlich Greenwich negativ, westlich Greenwich positiv
MIK-Werte
siehe VDI-Richtlinien
Mikrogramm
millionster Teil eines Gramms
MOZ
Mittlere Ortszeit; Stundenwinkel der mittleren Sonne
Nautische DĂ€mmerung
Die nautische DĂ€mmerung ist definiert als diejenige Zeitdauer, in der die Sonnenhöhe zwischen 0 und -12 Grad ist. Die nautische DĂ€mmerung ist kĂŒrzer als die astronomische DĂ€mmerung.
Niederschlag
NiederschlĂ€ge (Regen und Schnee) sind ein wichtiges Glied im Wasserkreislauf. Bei der Verdunstung geben die OberflĂ€chengewĂ€sser, die Böden und Pflanzen Feuchtigkeit an die Luft ab, dort bilden sich Wolken, die das verdunstete Wasser in Form von Regen oder Schnee dann wieder an die Erde zurĂŒckgeben. Durch den Niederschlag erhalten die Pflanzen alles Nötige, denn das in den Boden einsickernde Regenwasser löst und transportiert die dort angesammelten NĂ€hrstoffe und fĂŒhrt sie den Pflanzen zu. Die NiederschlĂ€ge speisen ebenfalls das Grundwasser, und ein Teil von ihnen verdunstet oder lĂ€uft ĂŒber die Ober-flĂ€chengewĂ€sser ab. Durch die zunehmende Luftverschmutzung reichern sich die NiederschlĂ€ge mit immer mehr Schadstoffen an (saurer Regen).
Obere Kulmination
Höhenwinkel der Sonne am Mittag
Ozon
Bodennahes Ozon entsteht in komplexen chemischen VorgĂ€ngen unter Einwirkung starker Sonnenstrahlung. An diesen VorgĂ€ngen sind neben dem natĂŒrlichen Sauerstoff Kohlenwasserstoffe und Stickstoffoxide beteiligt. Deshalb ist die Ozonkonzentration im Sommer am höchsten. SekundĂ€rschadstoff, wird in komplexen photochemischen Prozessen gebildet. Leitsubstanz fĂŒr Photooxidantien.
Ozonloch
WĂ€hrend das Ozon im unteren atmosphĂ€rischen Bereich hĂ€ufig belastend wirkt (Ozon), ĂŒbernimmt es als Filter in der StratosphĂ€re (AtmosphĂ€re), in einer Höhe zwischen 10 und 50 km ĂŒber dem Erdboden, eine elementare Schutzfunktion. Die Ozonschicht mindert das Durchdringen der im Sonnenlicht enthaltenen UV-Strahlung, die fĂŒr Pflanzen, Tiere und Menschen schĂ€dlich wirkt (Hautkrebs). Das ist eine Folge des Ozonabbaus in der StratosphĂ€re, ausgelöst durch FCKW bzw. seine Spaltprodukte (speziell Chlor). ZunĂ€chst wurde das Ozonloch nur ĂŒber dem SĂŒdpol festgestellt und in seinem GröĂenwachstum verfolgt. Inzwischen hat aber auch die AusdĂŒnnung der Ozonschicht ĂŒber dem Nordpol bedenkliche AusmaĂe angenommen. Fördernden EinfluĂ auf die Ozonbildung in der StratosphĂ€re kann man gegenwĂ€rtig ebensowenig ausĂŒben wie die weitere Wanderung der bereits emittierten FCKW, die zum Teil erst nach Jahren in der StratosphĂ€re ankommen, unterbinden. Deshalb bleibt nur die Möglichkeit, sich vor zu starker Sonneneinstrahlung zu schĂŒtzen.
Perzentil
Diese KenngröĂe ist der zur SummenhĂ€ufigkeit in % gehörende MeĂwert, der sich ergibt, wenn alle MeĂwerte nach der GröĂe ihres Zahlenwertes geordnet sind.
Platin
Platin wird als Katalysator (z.B. in Ottomotoren) verwendet sowie zu Tiegeln, Elektroden und SchmuckgegenstĂ€nden verarbeitet. In die Umwelt gelangt P. u.a. ĂŒber die natĂŒrliche Abnutzung der Abgaskatalysatoren in Autos. Man schĂ€tzt die jĂ€hrlich mit Automobilabgasen emittierte Menge fĂŒr die Bundesrepublik Deutschland auf ca. 200-250 kg.
ppm
Parts per million
Synonyme:
Parts per million
Punktdaten
FĂŒr einen bestimmten Ort durch Messung oder Rechnung ermittelte Daten.
Quecksilber
Das einzige bei Zimmertemperatur flĂŒssige Metall. Seine DĂ€mpfe und organischen Verbindungen, die insbesondere das zentrale Nervensystem schĂ€digen können, sind giftig.
Quellengruppe
Luftschadstoffen und Schallemittenten werden sogenannten Quellengruppen zugeordnet. Dies sind in erster Linie Autoverkehr, Kleinfeuerungsanlagen, Kraftwerke und Industrie.
RadioaktivitÀt
RadioaktivitĂ€t ist die Eigenschaft bestimmter Atomkerne, sich ohne Ă€uĂere Einwirkung in andere Atomkerne umzuwandeln und dabei eine charakteristische Strahlung (Alpha-, Beta- oder Gammastrahlen) auszusenden. Alpha-Strahlung besteht aus den bei der Spaltung entstehenden Atomkernen des Elementes Helium. Sie wird bereits durch ein Blatt Papier absorbiert (Absorption). FĂŒr den Menschen ist Alpha-Strahlung schĂ€dlich, wenn sie auf die Haut trifft oder in den Körper aufgenommen wird. Beta-Strahlung besteht aus Elektronen, die aus dem Atomkern stammen. Die biologische Wirkung im Gewebe ist geringer als die von Alpha-Strahlung. Eine kurzwellige und daher hochenergetische radioaktive Strahlung in Form von elektromagnetischen Wellen stellt die Gamma-Strahlung dar. Als Abschirmung eignet sich vor allem Blei. Vom Energiegehalt sind Gammastrahlen am ehesten mit Röntgenstrahlen zu vergleichen.
Rasterdaten
FĂŒr ein bestimmtes Gebiet durch Messungen oder Berechnungen flĂ€chenhaft ermittelte Daten.
Russ
Die lufthygienische Bedeutung von RuĂ, insbesondere von DieselruĂ, wurde in den letzten Jahren besonders durch toxikologische Untersuchungen stĂ€rker in die Diskussion gebracht. Die kanzerogene Wirkung von RuĂ beruht auf der mechanisch irritativen Eigenschaft der in den DieselruĂpartikeln enthaltenen Kohlenstoffkernen. GemÀà VDI-Richtlinie hat man sich darauf geeinigt, RuĂ als anorganischen Gesamtkohlenstoff zu analysieren und diesen als RuĂ in Mikrogramm pro Kubikmeter anzugeben. Entstehung hĂ€ufig verkehrsbedingt und innerhalb der Emittentengruppe "Verkehr" hauptsĂ€chlich von Lkw.
Sauerstoff
Sauerstoff ist ein farb-, geruch- und geschmackloses Gas und das Element, das auf der Erde am hĂ€ufigsten vorkommt. 89% des Wassers und 50% der Erdkruste bestehen aus Sauerstoff, den die Pflanzen mit Hilfe von BlattgrĂŒn und Licht erzeugen. Alle Tiere und Menschen, aber auch die Pflanzen selbst (bei Nacht) brauchen Sauerstoff zum Leben. SchlieĂlich wird Sauerstoff fĂŒr jede Verbrennung (Feuer) und fĂŒr viele weitere chemische und industrielle Prozesse benötigt.
Saurer Regen
Saurer Regen ist nicht nur eine der Ursachen fĂŒr das Baumsterben, sondern er lĂ€Ăt auch wertvolle KunstdenkmĂ€ler und historische Bauwerke »zu Gips zerfallen« (z.B. Kölner Dom). Schuld daran sind Schwefeldioxid (SO2) und Stickstoffoxide, die bei der Verbrennung von Ăl und Kohle entstehen. Diese giftigen Stoffe gelangen in die AtmosphĂ€re, lösen sich in den dort schwebenden Wassertröpfchen auf und fallen als SĂ€ure in Form von »saurem Regen«, Nebel oder Tau auf die Erde zurĂŒck. Durch moderne Entschwefelungsanlagen in Kohlekraftwerken und Industrieanlagen sowie die Verwendung schwefelarmer Kraftstoffe wurde der Eintrag von SO2 in die Umwelt in den letzten Jahren drastisch vermindert. In Zukunft kommt es vor allem darauf an, die Stickstoffoxid -Emissionen aus dem Verkehrsbereich zu vermindern.
Schadstoffausbreitung
Prozesse, die den Weg von Luftschadstoffen von der Quelle zum Immissionsort bestimmen.
Synonyme:
Emission, Immission
Schadstoffe
In der Umwelt vorkommende Stoffe, von denen schĂ€dliche Wirkungen auf Lebewesen oder andere Stoffe ausgehen. Zu den Schadstoffen zĂ€hlen u. a. Schwermetalle wie etwa Cadmium, Gase und Kohlenwasserstoffe. Verursacht werden Schadstoffe durch Fabriken, Kraftwerke, Kraftfahrzeuge und Haushaltsheizungen. Sie können von Mensch und Tier mit der Atmung, ĂŒber die Haut oder ĂŒber die Nahrung (Nahrungskette), von den Pflanzen ĂŒber Nadeln, BlĂ€tter oder Wurzeln aufgenommen werden. Saurer Regen begĂŒnstigt diesen Vorgang.
Schadstoffemission
Schadstoffe, die in die offene AtmosphÀre austreten.
Schadstoffkonzentration
Masse der luftverunreinigenden Stoffe bezogen auf das Volumen der verunreinigten Luft. Angabe als Massenkonzentration in der Einheit mg/m3. Bei Gasen auch Volumen der luftverunreinigenden Stoffe bezogen auf das Volumen der verunreinigten Luft.
Schadstoffwindrose
Mittlere Schadstoffkonzentration in AbhÀngigkeit von der Windrichtung.
Schall
Mechanische Schwingungen und Wellen in einem elastischen Medium. Beim hörbaren Schall handelt es sich um Schwingungen im Frequenzbereich von 16 Hz bis etwa 20 000 Hz, welche mit Hilfe des Ohres Ton-, Klang- oder GerÀuscheempfindungen auslösen. Bei tieferen Frequenzen ist es Infraschall, bei höheren Ultraschall.
Schallwelle
Der Schall kann sich in jedem elastischen Medium (Festkörper, FlĂŒssigkeit, Luft) ausbreiten. Das wichtigste Ausbreitungsmedium ist die Luft (Luftschall).
Schwefeldioxid
Schwefeldioxid (SO2) wird bei Verbrennungsprozessen durch die Oxidation des im Brennstoff enthaltenen Schwefels gebildet. Es ist ein farbloses Gas, das in höheren Konzentrationen riecht und ab ca. 0.3 ppm geschmacklich wahrnehmbar ist. Schwefeldioxid ist ein wasserlösliches Reizgas, das auf die SchleimhÀute der Augen und der oberen Atemwege wirkt. Entsteht in Stuttgart heute hauptsÀchlich durch Hausbrand (Verwendung von schwefelhaltigen Brennstoffen wie Kohle, Heizöl etc.).
Screeningmodell
Vereinfachtes Modell das mit geringem Daten- und Rechenaufwand der AbschÀtzung von (hier) Schadstoffbelastungen dient.
Smog
Situation hoher Luftverschmutzung. Der Smogtyp "Los Angeles" wird verursacht durch hohe Kraftfahrzeugemissionen (Stickoxide, Kohlenwasserstoffe, Kohlenmonoxid). Infolge schlechten Luftaustausches, verbunden mit starker Sonneneinstrahlung, kommt es zu chemischen Umwandlungen der Gase in der AtmosphĂ€re und zur Bildung von Photooxidantien. Zu den wichtigsten Stoffen zĂ€hlt hier das Ozon. MaĂnahmen gegen diesen "Sommersmog" regelt das Bundes-Immissionsschutzgesetz im Paragraph 40. Der Smogtyp "London" entsteht bei Inversionswetterlagen im Winter. Hauptschadstoffkomponenten sind Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid und Staub. Da bei diesen Schadstoffen eine deutliche Besserung eingetreten ist, tritt dieser Smogtyp in Stuttgart nicht mehr auf. Die entsprechende Smogverordnung wurde Anfang 1997 auĂer Kraft gesetzt.
Solarstrahlung
Die von der Sonne (schwarzer Strahler von ca. 6000 K) ausgehende Strahlung erreicht nicht vollstĂ€ndig den Erdboden. Beim Durchgang durch die AtmosphĂ€re erfĂ€hrt die Solar-Strahlung eine AbschwĂ€chung, die unter dem Begriff Extinktion zusammengefaĂt wird. Der sichtbare Bereich der Solarstrahlung auch Licht genannt, nimmt nur den kleinen WellenlĂ€ngenbereich von ca. 0,4 - 0,75m m ein. Die IntensitĂ€t der Sonneneinstrahlung auf eine horizontale FlĂ€che ist abhĂ€ngig von der auftreffenden Sonnenstrahlung und der Sonnenhöhe.
Solarstrahlung
Durch den Neigungswinkel eines Hanges und seiner Orientierung wird der Einfallswinkel der Solarstrahlung zur bestrahlten HangflĂ€che ebenso verĂ€ndert wie die zeitliche Verschiebung des Sonnenaufganges und- unterganges. GEIGER (1961) hat schon 1961 fĂŒr verschiedene Hangrichtungen die Einstrahlungssummen der direkten Sonnenstrahlung in AbhĂ€ngigkeit von verschiedenen Hangneigungen berechnet. Deutlich ausgeprĂ€gt ist das Strahlungsdefizit des Nordhanges besonders im Winter. Beim SĂŒdhang, der strahlungsmĂ€Ăig bevorzugt ist, verschiebt sich das Maximum der Einstrahlung, das immer um 12 h (Ortszeit!) auftritt im Winter zu gröĂeren Hangneigungen, hervorgerufen durch den niedrigeren Sonnenstand.
Sommertag
Tag mit Maximaltemperatur von mindestens 25 Grad C.
Sonnenhöchststand
Die Sonnenhöhe wird in Grad angegeben. Null Grad bedeuten, dass die Sonne gerade am Horizont und 90 Grad, dass die Sonne senkrecht ĂŒber dem Betrachter steht. In der Regel liegt der Wert des Sonnenhöchststandes zwischen 0 und 90 Grad. Ist er unter Null, so geht die Sonne ĂŒberhaupt nicht auf (z.B. im Winter bei hohen nördlichen Breiten).
Ist der Sonnenhöchststand zwischen 0 und 90 Grad, so befindet sich die Sonne, wenn man sich auf der nördlichen Erdhalbkugel aufhĂ€lt, im SĂŒden und umgekehrt.
Ist der Sonnenhöchststand ĂŒber 90 Grad, so befindet sich auf der nördlichen Erdhalbkugel die Sonne auch im Norden. Anschaulich gesprochen sieht dann ein auf der Nordhalbkugel stehender und nach SĂŒden blickender Beobachter die Sonne hinter sich!
Sonnenhöhe
Winkelabstand der Sonne vom Horizont
Sonnenscheindauer
Summe derjenigen Zeitabschnitte eines Tages, zu denen die Sonne sichtbar geschienen hat
Sonnenstrahlung
Die auf die Erde einfallende Strahlung der Sonne im WellenlÀngenbereich von 0,29 mm bis 4 mm
Stadtklima
WĂ€hrend das Klima in der freien Landschaft weitgehend von natĂŒrlichen Gegebenheiten abhĂ€ngig ist, bildet sich in Stadtlandschaften ein durch Bauwerke beeinfluĂtes Klima aus, das Stadtklima. Man versteht darunter aber auch die VerĂ€nderung der natĂŒrlichen Zusammensetzung der Luft durch anthropogene EinflĂŒsse. Stadtklima = Klima und Lufthygiene in der Stadt
Staub (und dessen Inhaltsstoffe)
Entsteht bei Verbrennungprozessen, industriellen Fertigungsprozessen, durch Abrieb im StraĂenverkehr (Reifen, Bremsen etc.). Der natĂŒrlicher Anteil relativ hoch.
Stickstoffdioxid
Stickstoffdioxid (NO2) ist ein rötlich braunes Gas mit stechend-reizendem Geruch und sehr korrosiver Wirkung. Bei starker Sonnenstrahlung wird es zu NO und O reduziert und trÀgt so zur Ozonbildung bei. NO2 ist ein Reizgas, das vor allem die SchleimhÀute des A-temtraktes schÀdigt.
Stickstoffmonoxid
Stickstoffmonoxid (NO) entsteht durch biologische Prozesse und bei Verbrennungspro-zessen durch Oxidation des in der Luft vorhandenen Stickstoffs. NO wird durch photochemische Zweitreaktionen unter Einwirkung des Sonnenlichtes in Stickstoffdioxid (NO2) umgewandelt.
Stickstoffoxide
Entstehen in Stuttgart heute ĂŒberwiegend durch Verkehr. SchĂ€dliche Umwelteinwirkung durch Stickstoffdioxid (NO2) und durch Mitwirkung bei der Ozonbildung.
Strahlung
Unter Strahlung versteht man physikalisch einen FluĂ von elektromagnetischen Wellen. Im internationalen Einheitensystem (SI-System) ist die Energieeinheit das Joule (1J = 1Nm) und der StrahlungsfluĂ wird in der Einheit J/s mÂČ angegeben, was gleichbedeutend der Einheit W/mÂČ ist. In Ă€lteren LehrbĂŒchern ist als Einheit die cal gebrĂ€uchlich.
Strahlungsdichte
Energiedichte der einfallenden Sonnenstrahlung; bezogen auf die bestrahlte FlĂ€che. Einheit: Joule pro Quadratmeter ( J/mÂČ )
StrahlungsfluĂ
Energiefluss- bzw. Leistungsdichte der einfallenden Sonnenstrahlung; bezogen auf die bestrahlte FlĂ€che. Einheit: Watt pro Quadratmeter ( W/mÂČ )
Stuttgart 21
Name fĂŒr eine umfassende Planung in Stuttgart: Umnutzung eines etwa 100 ha groĂen BahngelĂ€ndes im klimatisch sensiblen Stuttgarter Innenstadtkessel.
TA-Luft
Die TA-Luft (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft) regelt fĂŒr genehmigungsbedĂŒrftige Anlagen sowohl Schadstoffemissionen als auch Schadstoffimmissionen mit dem Ziel, Menschen sowie Tiere, Pflanzen und andere Sachen vor schĂ€dlichen Umwelteinwirkungen zu schĂŒtzen.
Synonyme:
Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft
Toluol
Farblose, aromatische Verbindung mit benzolĂ€hnlichem Geruch. Toluol findet u. a. Verwendung als Lösemittel, Reinigungsmittel, Benzinzusatz und als Ersatzstoff fĂŒr Benzol. Es kann in höheren Konzentrationen u. a. Schleimhautreizungen, Störungen des Nervensystems sowie SchĂ€digung an Leber, Nieren und Gehirnzellen verursachen.
Ton
Schallschwingung mit einer einzigen festen Frequenz.
Treibhauseffekt
Die fortschreitende Aufheizung der AtmosphĂ€re mit der Folge einer weltweiten KlimaverĂ€nderung ist schon in den 80er Jahren erkannt und von der Bundesregierung aufgenommen worden. Man erklĂ€rt sich den Treibhauseffekt so, daĂ ein groĂer Teil der kurzwelligen Sonnenstrahlen zwar ungehindert die AtmosphĂ€re durchdringen, aber als langwelligere reflektierte WĂ€rmestrahlung nicht mehr zurĂŒck ins Weltall gelangen können, weil sie durch die sogenannten Treibhausgase in bodennahen Luftschichten teilweise absorbiert werden. Dieser Effekt ist dem eines Glasdachs bei GewĂ€chshĂ€usern zu vergleichen und wurde daher mit seinem Namen belegt. Neben diesem kĂŒnstlichen kennt man allerdings auch einen natĂŒrlichen T.: Die natĂŒrlich vorkommenden Gase wie Kohlendioxid, Wasserdampf und Ozon sorgen fĂŒr den Effekt, daĂ unsere Erde ein globales Temperaturjahresmittel von 15°C zeigt; wĂ€re die Erde ungeschĂŒtzt und könnte die WĂ€rme nicht zurĂŒckhalten, wĂ€re mit Temperaturen um -18°C zu rechnen. Der kĂŒnstliche T. ist also nur die zusĂ€tzliche Freisetzung von treibhauswirksamen Gasen, die die globalen Temperaturen um einige Grad erhöhen können (bislang etwa 0,5 bis 0,7 °C in den letzten 100 Jahren). Zu den Treibhausgasen gehört u.a. die Gruppe der FCKW, Kohlendioxid als wesentlichstes, Methan und Wasserdampf. Vorsichtige SchĂ€tzungen gehen bei weiter anwachsender Bevölkerung in den nĂ€chsten 50 Jahren von einer globalen Temperaturerhöhung um 1,5 bis 4,5 °C aus. Folgen von Temperaturerhöhungen sind z.B. das Steigen des Meerwasserspiegels um etwa 30 cm durch das Abtauen des Polkappeneises oder eine Verschiebung der Klimazonen. Insgesamt ist dadurch mit einer Abnahme der landwirtschaftlich nutzbaren FlĂ€chen zu rechnen - und das bei der weiter steigenden Weltbevölkerung.
Tropopause
Grenzschicht zwischen TroposphÀre und StratosphÀre.
TroposphÀre
Bezeichnung fĂŒr das »unterste Stockwerk« der AtmosphĂ€re, wo fast der gesamte Wasserdampf der AtmosphĂ€re enthalten ist und sich das Wettergeschehen abspielt. Hier vollziehen sich auch die OzonbildungsvorgĂ€nge, die man zusammenfassend als Sommer-Smog bezeichnet (Smog). Die T. ist gekennzeichnet durch eine Temperaturabnahme nach oben von 6 bis 8 °C pro Kilometer.
Umweltbericht
Seit den siebziger Jahren sind Bund, LĂ€nder, Landkreise, StĂ€dte und Gemeinden und seit einiger Zeit auch immer mehr Firmen dazu ĂŒbergegangen, in regelmĂ€Ăigen AbstĂ€nden einen Umweltbericht vorzulegen. Darin stellt beispielsweise eine Gemeinde dar, was sie zum Schutz und zur Sicherung der Umwelt in ihrem ZustĂ€ndigkeitsbereich geleistet hat und welche Vorhaben noch geplant sind. Umweltberichte dienen der Information der Bevölkerung. Sie sind freiwillig.
Umweltschutz
Gesamtheit der MaĂnahmen, die Behörden, Unternehmen und Privatpersonen ergreifen, um die Lebensgrundlagen Luft, Boden und Wasser, ihre ZusammenhĂ€nge untereinander sowie das Leben von Mensch, Tier und Kleinlebewesen in ihnen vor nachteiligen VerĂ€nderungen, insbesondere vor nachhaltiger Verschmutzung zu schĂŒtzen.
UV-A Strahlung
Die langwellige UV-Strahlung im Spektralbereich > 0,313 mm. Sie ist wichtig zur StĂ€rkung des menschlichen Immunsystems und verantwortlich fĂŒr die HautbrĂ€unung.
UV-B Strahlung
Die kurzwellige UV-Strahlung im Spektralbereich < 0,313 mm. Sie ist gefĂ€hrlich fĂŒr irreversible HautschĂ€den des Menschen (Hautkrebs).
UV-Index
Der UV-Index ist definiert als Tageshöchstwert der sonnenbrandwirksamen BestrahlungsstĂ€rke in W/m2, arithmetisch gemittelt ĂŒber 10 - 30 Minuten und multipliziert mit 40. Diese Definition ist international akzeptiert [WMO 94]. Die sonnenbrandwirksame BestrahlungsstĂ€rke ist das Produkt der spektralen BestrahlungsstĂ€rke am Erdboden, gemessen fĂŒr eine horizontale BezugsflĂ€che, mit der relativen spektralen Standard-Erythem-wirksamkeit nach CIE [CIE 87 a], integriert ĂŒber den gesamten UV-Bereich. Der UV-Index ist eine GröĂe zur Beschreibung des am Erdboden zu erwartenden Tagesspitzenwertes der sonnenbrandwirksamen UV-Strahlung. Der einfachen VerstĂ€ndlichkeit halber wurde er so normiert, daĂ er derzeit praktisch Zahlenwerte zwischen 1 und 12 annehmen kann. Der Maximalwert fĂŒr die Bundesrepublik Deutschland im Sommer betrĂ€gt im allgemeinen 8; in sĂŒdlicheren LĂ€ndern werden höhere Werte erreicht.
UV-Strahlung
Die ultraviolette Strahlung, unterhalb der sichtbaren Strahlung im Spektralbereich < 0,36 mm. Gesundheitstipp: Sich ĂŒbermĂ€Ăig der Sonnenstrahlung und damit auch der ultravioletten (UV) Strahlung auszusetzen, birgt fĂŒr jedermann gesundheitliche Risiken - akut schmerzlich als Sonnenbrand zu erfahren. Die gefĂ€hrlichsten Langzeitfolgen ĂŒbermĂ€Ăiger Sonnenbestrahlung sind Hautkrebserkrankungen, die in der hellhĂ€utigen Bevölkerung weltweit zunehmen - in unseren Breitengraden jĂ€hrlich um etwa 7%. Das ist die höchste Zuwachsrate aller bösartigen Tumore. Die Ursache hierfĂŒr liegt darin, daĂ sich die BĂŒrger in den letzten Jahrzehnten insbesondere infolge verĂ€nderter Urlaubs- und Freizeitgewohnheiten bewuĂt verstĂ€rkt der Sonnenbestrahlung ausgesetzt haben. GebrĂ€unte Haut gilt seit den 50er Jahren als Symbol fĂŒr Gesundheit, Jugend und Schönheit. Neuere Forschungsergebnisse lassen den SchluĂ zu, daĂ zwischen der Entstehung von Tumoren der Haut und der ultravioletten Strahlung (UV-B) ein direkter Zusammenhang besteht. Insbesondere ist die UV-Dosis, die man sich in den ersten Lebensjahren erwirbt, ein bestimmender Faktor bei der Entstehung von Hauttumoren im spĂ€teren Lebensalter.
VDI-Richtlinien
Die VDI-Richtlinien fĂŒr Maximale Immissionskonzentrationen (MIK) befassen sich mit der Festlegung von Grenzwerten fĂŒr bestimmte Luftverunreinigungen. Sie sind definiert als diejenigen Konzentrationen, unterhalb derer nach dem heutigen Wissensstand Mensch, Tier, Pflanze und SachgĂŒter nach MaĂgabe der PrĂ€ambel sicher geschĂŒtzt sind. Sie sind gemÀà dem Auftrag der VDI-Kommission Reinhaltung der Luft Entscheidungshilfen fĂŒr die Ableitung gesetzlicher Normen, ohne jedoch unmittelbaren Bezug auf immissionsschutzrechtliche Bestimmungen aufzuweisen.
Verschattung
Verschattung bedeutet Verminderung der astronomisch möglichen Besonnung durch HorizontĂŒberhöhung (z.B. Berge) oder umgebende Baulichkeiten. Vor allem bei Tallagen und nordexponierten Lagen, aber auch im Bereich dichter, stĂ€dtischer Bebauung ergeben sich empfindliche EinschrĂ€nkungen der Sonnenscheindauer und damit auch der zugestrahlten Energie. Aufgrund der Verschattung bei niedrigem Sonnenstand erhalten NordhĂ€nge mit Neigungen bis 10° im Winter 10% bis 30% weniger Globalstrahlung als sĂŒdlich exponierte Lagen. Nordhangbebauungen sollten daher so weit wie möglich vermieden werden, da diese mikroklimatischen Nachteile nur unzureichend durch andere bauliche oder siedlungsstrukturelle MaĂnahmen kompensiert werden können (DĂTZ u. MĂRTIN, 1982).
Vorbelastung
Vorhandene Immissionsbelastung ohne den Beitrag der zu beurteilenden StraĂe.
wahre Mittagszeit
Stundenwinkel der wahren Sonne am Mittag
Wasserstoff
H2 ist eines der hĂ€ufigsten Elemente auf der Erde. Es verbrennt fast schadstofffrei und hat pro Gewichtseinheit einen etwa 3x so groĂen Heizwert wie Erdöl. Diese Eigenschaften lassen H2 zunĂ€chst als idealen EnergietrĂ€ger erscheinen. Vor Anwendung muĂ H2 jedoch von seiner Bindung an andere Elemente gelöst werden. Die H2-Gewinnung kann durch elektrolytische Spaltung aus Wasser oder durch chemische Umwandlungsprozesse aus fossilen EnergietrĂ€gern erfolgen. Derzeit dominieren die auf fossilen EnergietrĂ€gern basierenden Produktionsverfahren (77%). Die Energiegewinnung und die dafĂŒr eingesetzte Art der Energie (ideal ist »Sanfte Energie«) bestimmt letztlich die Ăkobilanz. Als alternativer Kraftstoff wird H2 derzeit erprobt. H2-Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor emittieren nahezu kein CO2, nahezu keine kohlenstoffhaltigen Verbindungen und Partikel und nur in geringem Umfang NOx. Die Reichweite von H2-Fahrzeugen ist, wie bei fast allen alternativen Kraftstoffen, eingeschrĂ€nkt. Denn der Energiegehalt pro Volumen betrĂ€gt nur etwa 1/3 im Vergleich zu Benzin. Dies macht auch die Speicherung schwierig. Die technisch und emissionsmĂ€Ăig bessere Nutzung von H2 ist, nicht nur im Verkehrsbereich, die Verwendung in der Brennstoffzelle.
Wind
Der Wind wird durch Geschwindigkeit und Richtung bestimmt.
Windgeschwindigkeit
Geschwindigkeit des Windes. Es gelten folgende Umrechnungen: 1 m/s = 1.943 Knoten = 3.6 km/h.
Windrichtung
Die Windrichtung gibt die Richtung an, aus der der Wind weht. Windrichtungen werden in unterschiedlichen Windrichtungsskalen zusammengefaĂt. HĂ€ufig ist eine 12 und 16-teilige Untergliederung der Windrichtungen von 0 Grad bis 360 Grad.
Windrose
Prozentuale Verteilung der WindrichtungshÀufigkeit an einem Standort
Xylol
Xylol welches hĂ€ufig mit Benzol und Toluol unter dem Begriff BTX-Aromaten zusammengefaĂt wird, zĂ€hlt zu den einfachsten aromatischen Kohlenwasserstoffverbindungen. Als Bestandteil von Kraftstoffen gelangt es ĂŒber die Kfz-Abgase sowie ĂŒber die Verdunstung aus Kraftstofftanks in die AtmosphĂ€re. Xylol dient auch als Lösemittel fĂŒr Gummi, Lacke und Ăl.
Zeitgleichung
Die Zeitgleichung beschreibt die Differenz zwischen wahrer Ortszeit und mittlerer Ortszeit. Die Abweichungen entstehen durch die Neigung und leichte ExzentrizitÀt der Erdbahn und die dadurch bedingten Schwankungen der TaglÀnge.
Zielwert
Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Stuttgart hat 1994 UmweltqualitĂ€tsziele Luft beschlossen. Die Zielwerte sollen kĂŒnftig in zeitlicher Abstufung sowohl punktuell als auch flĂ€chenhaft eingehalten werden.
Zonenzeit
Jeweilige Uhrzeit in einer Zeitzone bezogen auf Greenwich Meantime
Zusatzbelastung
Immissionsbelastung, die ausschlieĂlich durch die zu beurteilende StraĂe hervorgerufen wird.